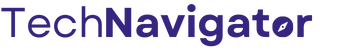Die wachsende Abhängigkeit von wenigen Technologieanbietern stellt eine zentrale Herausforderung für die Handlungsfähigkeit von Staaten, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sowie Individuen dar.
Dieser Artikel beleuchtet die facettenreiche Bedeutung digitaler Souveränität und zeigt auf, wie durch gezielte Strategien und den Einsatz von Open Source eine selbstbestimmte und sichere digitale Zukunft in der öffentlichen Verwaltung und darüber hinaus gestaltet werden kann. Erfahren Sie, warum digitale Souveränität kein abstraktes Konzept, sondern eine dringliche Notwendigkeit für unsere Gesellschaft im digitalen Zeitalter ist.
Die digitale Herausforderung unserer Zeit
Die fortschreitende Digitalisierung durchdringt alle Bereiche unseres Lebens und bietet immense Chancen für Innovation und Fortschritt. Gleichzeitig führt sie zu einer immer stärkeren Abhängigkeit von digitalen Technologien und Infrastrukturen, die oft von wenigen globalen Akteuren bereitgestellt werden. Diese Abhängigkeit wirft grundlegende Fragen nach der Handlungsfähigkeit, Selbstbestimmung und Autonomie von Staaten, Unternehmen und Bürgern in der digitalen Welt auf. Die Debatte um digitale Souveränität ist daher aktueller denn je und prägt zunehmend den politischen Diskurs in Deutschland und Europa.
Das Konzept der „digitale Souveränität“ beschreibt „die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können“. Es geht darum, die Hoheit über die eigenen Daten und Systeme zu bewahren und nicht in unausweichliche Abhängigkeiten zu einzelnen Anbietern zu geraten.
Dies umfasst sowohl die technologische Souveränität als auch die Datensouveränität, um die digitalen Infrastrukturen und Anwendungen gemäß den eigenen Werten und Interessen gestalten zu können. Ohne eine bewusste Stärkung der digitalen Souveränität riskieren wir weitreichende Folgen für unsere Sicherheit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Demokratie selbst.
Was bedeutet digitale Souveränität und warum ist sie so entscheidend?
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit und Möglichkeit, im digitalen Raum autonom zu handeln, digitale Technologien sowie IT-Infrastrukturen selbstbestimmt zu gestalten und die volle Kontrolle über eigene und anvertraute Daten zu behalten. Sie ist nicht gleichbedeutend mit technologischer Autarkie, sondern bedeutet informierte Entscheidungsfreiheit und Transparenz über digitale Abhängigkeiten.
Dies ermöglicht es, kritische Systeme unabhängig weiterbetreiben zu können und Gestaltungsspielräume bei der Wahl von Technologiepartnern zu haben. Insbesondere für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Deutschland und Europa ist digitale Souveränität nicht nur ein Ideal, sondern eine Notwendigkeit.
Die Bedeutung digitale Souveränität erstreckt sich über verschiedene Dimensionen. Auf individueller Ebene geht es darum, allen Menschen die selbstbestimmte Nutzung digitaler Technologien zu ermöglichen und ihre digitale Selbstbestimmung zu stärken, inklusive eines souveränen Umgangs mit digitalen Medien und relevanten Sicherheitsaspekten.
Für die Wirtschaft bedeutet sie die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung von Innovation im eigenen Land durch die Reduzierung von Abhängigkeit. Auf staatlicher Ebene gewährleistet sie die Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten und den Schutz kritischer Infrastruktur vor externen Einflüssen.
Die Dringlichkeit digitaler Souveränität: Sind wir zu abhängig?
In einer zunehmend digitalen Welt ist die Frage nach der Kontrolle über unsere Daten, Infrastruktur und digitale Werkzeuge keine rein technische mehr. Laut einer Bitkom-Studie importieren 96 Prozent der deutschen Unternehmen digitale Technologien und Services aus dem Ausland. Diese einseitige Abhängigkeit gefährdet nicht nur die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die technologische Selbstbestimmung Deutschlands.
Besonders hoch ist die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern aus den USA und China, was sich in sensiblen Bereichen wie Datensicherheit und technologischer Verantwortung als Risiko erweist, etwa durch den US CLOUD Act.
Welche Risiken birgt die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern?
Die Abhängigkeit von digitalen Technologien und Anwendungen ausländischer Einzelnen Anbietern birgt vielfältige Risiken. Preiserhöhungen, plötzliche Änderungen der Nutzungsbedingungen, politische Sanktionen oder die Einstellung von Services können die Geschäftskontinuität gefährden. Darüber hinaus besteht die Gefahr von sogenannten Lock-in-Effekten, bei denen Nutzer gezwungen sind, an bestimmte Technologien oder Anbieter gebunden zu bleiben, da ein Wechsel mit erheblichen Kosten und Aufwänden verbunden wäre.
Dies kann die Flexibilität und Innovation in der IT der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft beeinträchtigen. Die Deutsche Telekom betont: „Ohne digitale Souveränität riskieren Unternehmen und Regierungen weitreichende Folgen für Sicherheit, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.“
Die Hoheit über die eigenen Daten ist ein weiterer kritischer Aspekt. Werden Daten in Cloud-Lösungen externer Anbieter gespeichert, insbesondere außerhalb der EU, kann die Kontrolle über diese sensiblen Informationen verloren gehen. Dies betrifft nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch die öffentliche Verwaltung, die mit Bürgerdaten arbeitet.
Die IT-Sicherheit und der Datenschutz gemäß nationalen und europäischen Vorgaben können in solchen Fällen nicht mehr sicherstellen werden. Das Wissen über den Quellcode proprietärer Software bleibt oft den Herstellern vorbehalten, was die Möglichkeit zur unabhängigen Prüfung auf Schwachstellen und zur Anwendung an spezifische Bedürfnisse stark einschränkt.
Geopolitische Realitäten und die digitale Handlungsfähigkeit
In Zeiten geopolitischer Spannungen und hybrider Kriegsführung gewinnt die digitale Souveränität noch mehr an Bedeutung. Die Abhängigkeit von digitalen Technologien aus Ländern wie den USA und China birgt erhebliche Risiken für die nationale Sicherheit und die Handlungsfähigkeit eines Staates. Cyberattacken und Spionage können kritische Infrastrukturen bedrohen und das Vertrauen der Bevölkerung sowie internationaler Partner untergraben. Die Lieferketten für digitale Technologien sind global vernetzt und anfällig für Störungen, die weitreichende Konsequenzen haben können.
Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, betonte auf der diesjährigen Smart Country Convention: „Die Grundvoraussetzung für selbstbestimmtes Handeln ist unsere digitale Souveränität. Ein Leben, wie wir es in vielen Teilen Europas für selbstverständlich halten, also ein Leben in Freiheit, Demokratie und Wohlstand, setzt diese digitale Souveränität voraus.
Sie besitzt viele Facetten. Von der technologischen Souveränität, über Datensouveränität bis hin zur Cybersicherheit und der Leistungsfähigkeit unserer digitalen Infrastruktur.“ Diese Aussage unterstreicht, dass digitale Souveränität weit mehr als ein technisches Schlagwort ist; sie ist ein fundamentaler Pfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wirtschaftlichen Stabilität.
Pfeiler der digitalen Autarkie: Wie wird man digital souverän?
Die Erreichung digitaler Souveränität ist eine vielschichtige Aufgabe, die ein koordiniertes Vorgehen auf mehreren Ebenen erfordert. Es geht nicht um eine vollständige Abschottung oder Autarkie, sondern um die Schaffung von Wahlmöglichkeiten, die Reduzierung von einseitigen Abhängigkeiten und die Stärkung der eigenen Gestaltungshoheit.
Dies erfordert Investitionen in kritische Infrastrukturen, die Förderung alternativer Technologien und den Aufbau umfassender Kompetenzen in allen Bereichen der Gesellschaft. Eine Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität muss dabei sowohl technische als auch organisatorische und bildungspolitische Aspekte berücksichtigen.
Welche Rolle spielen leistungsfähige und sichere Infrastrukturen?
Eine leistungsfähige und sichere digitale Infrastruktur bildet das Fundament für digitale Souveränität. Dazu gehört der Ausbau von Breitbandnetzen und Mobilfunknetzen der fünften Generation, die als elementare Voraussetzung für Innovation und die Entwicklung neuer digitaler Produkte gelten. Ebenso wichtig ist es, dass diese Infrastruktur vertrauenswürdig ist und vor Cyberangriffen geschützt werden kann. Die Kontrolle über die eigenen digitalen Infrastrukturen ist unerlässlich, um die IT-Sicherheit und den Datenschutz sicherstellen zu können und die Resilienz gegenüber externen Bedrohungen zu erhöhen.
Die Entwicklung und der Betrieb souveräner Cloud-Lösungen sind hierbei ein zentraler Baustein. Anstatt sich auf Cloud-Anbieter zu verlassen, deren Server und Datenzentren außerhalb des eigenen Rechtsraums liegen, sollte der Fokus auf europäischen Lösungen liegen. Initiativen wie Gaia-X als europäische Cloud-Plattform sind Beispiele für Bestrebungen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit des digitalen Binnenmarktes zu fördern und Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Cloud Computing voranzutreiben. Dies stärkt die digitale Souveränität und mindert die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern.
Ist Open Source der Schlüssel zur Selbstbestimmung in der digitalen Welt?
Open Source Software (OSS) wird als ein zentrales Element zur Steigerung der digitalen Souveränität angesehen. Die Transparenz des Quellcodes bei Open Source Lösungen ermöglicht eine unabhängige Prüfung auf Schwachstellen, fördert das Vertrauen in die Technologie und erlaubt es, Anwendungen an spezifische Bedürfnisse anzupassen. Dies verringert die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und erhöht die Flexibilität. Organisationen, die Open Source nutzen, sind nicht an einen einzigen Anbieter gebunden und haben die Freiheit, zwischen verschiedenen Anbietern zu wählen oder die Software selbst zu hosten und anzupassen.
Der Einsatz von Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung kann maßgeblich dazu beitragen, die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist das Zentrum für Digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung (ZenDiS), das als Kompetenz- und Servicezentrum für Bund, Länder und Kommunen fungiert und die Nutzung von Open Source fördert.
Es entwickelt und koordiniert Open Source Projekte, wie openCoDE und openDesk, um die Verwaltung von Abhängigkeiten zu einzelnen Anbietern zu lösen und ein leistungsfähiges Open Source Ökosystem aufzubauen. Der Einsatz von Open Source wirkt somit wie ein Katalysator für mehr digitaler Souveränität.
Wie fördern wir digitale Kompetenzen und Bildung?
Digitale Souveränität ist untrennbar mit digitalen Kompetenzen verbunden. Um in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher agieren zu können, benötigen Individuen, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung umfassende digitale Bildung und Kompetenzen. Dies umfasst nicht nur den souveränen Umgang mit digitalen Medien, sondern auch das Verständnis für IT-Sicherheit, Datenschutz und die Funktionsweise digitaler Technologien. Nur wer die Mechanismen der digitalen Transformation versteht, kann bewusste Entscheidungen treffen und seine digitale Selbstbestimmung wahren.
Es sollte im Interesse von Politik und Wirtschaft sein, durch vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebote auf allen Ebenen – von der Schule über die berufliche Bildung bis zur akademischen Bildung – aktuelle Kompetenzen zu vermitteln. Dies ermöglicht einen digital souveränen und sicheren Umgang mit digitalen Technologien und befähigt Bürger, aktiv an einer digitalen Gesellschaft teilzuhaben. Programme zum Kompetenzaufbau und zur Beratung, wie sie beispielsweise das Zentrum für Digitale Souveränität anbietet, sind entscheidend, um die Lücke zwischen technologischen Möglichkeiten und dem Wissen zu schließen, diese selbstbestimmt zu nutzen.
Digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung: Ein Leuchtturmprojekt?
Die öffentliche Verwaltung in Deutschland steht vor der Mammutaufgabe, ihre digitale Souveränität zurückzugewinnen und sich von außereuropäischen IT-Anbietern unabhängiger zu machen. Dies ist eine der größten Herausforderungen der digitalen Ära, da jahrzehntelang auf IT-Lösungen internationaler Anbieter vertraut wurde, was zu weitreichenden Abhängigkeiten geführt hat. Die Stärkung der digitalen Souveränität der öffentlichen Verwaltung ist daher ein strategisches Ziel von Bund, Länder und Kommunen.
Was leistet das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS)?
Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist das Zentrum für Digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung (ZenDiS), das Ende 2022 gegründet wurde. Das ZenDiS fungiert als Kompetenz- und Servicezentrum, das die öffentliche Verwaltung in Bund, Länder und Kommunen berät und die Nutzung von Open Source Software fördert. Es soll als Bindeglied zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Akteuren des Open Source-Ökosystems agieren, Markttrends eruieren und Anforderungen der Verwaltung in Open Source-Communities kommunizieren.
Die Mission des ZenDiS ist es, die Verwaltung in Deutschland zu befähigen, sich aus kritischen Abhängigkeiten von einzelnen Technologieanbietern zu lösen. Hierzu konzentriert es sich auf die Bereitstellung bedarfsgerechter IT-Lösungen auf Open Source-Basis, inklusive verlässlicher Betriebsmodelle wie openDesk als Office-Alternative, und betreibt die Plattform openCoDE für den Austausch und die Weiterentwicklung von Open Source-Projekten. Dies fördert die Gestaltungsfähigkeit und Wechselmöglichkeit der Verwaltung und trägt maßgeblich zur Stärkung der digitalen Souveränität bei.
Wie stärken Bund, Länder und Kommunen ihre digitale Souveränität?
Bund, Länder und Kommunen haben sich im Rahmen eines gemeinsamen Eckpunktepapiers und einer darauf aufbauenden Strategie zur Stärkung der Digitalen Souveränität für die IT der Öffentlichen Verwaltung auf drei strategische Ziele verständigt: Wechselmöglichkeit, Gestaltungsfähigkeit und Einfluss auf Anbieter. Diese Ziele sollen durch acht zugehörige Lösungsansätze und konkrete Maßnahmen erreicht werden. Dazu gehört die Diversifizierung und Schaffung von Alternativen, insbesondere durch europäische Lösungen und Open Source Software-Ansätze, um bestehende Abhängigkeiten zu identifizieren und aufzulösen.
Die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung bedeutet, dass Verwaltungen und IT-Dienstleister die volle Kontrolle über ihre digitalen Infrastrukturen, Softwarelösungen und Daten behalten. Sie sollen unabhängig entscheiden können, welche Technologien sie nutzen, ohne auf Anbieter angewiesen zu sein, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen. Ein wichtiger Baustein hierfür ist auch die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie (DVS), die auf einheitliche Standards und offene Schnittstellen abzielt, um eine modulare und interoperable Cloud-Infrastruktur für Bund, Länder und Kommunen zu schaffen. Der CIO Bund spielt hierbei eine koordinierende Rolle.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation meistern
Die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung ist komplex und birgt zahlreiche Herausforderungen. Neben der Reduzierung von Abhängigkeiten und dem Aufbau souveräner digitaler Infrastrukturen sind auch der Kompetenzaufbau beim Personal und die Schaffung innovationsoffener Rahmenbedingungen entscheidend. Viele Cloud-Angebote der föderalen Verwaltung sind aufgrund fehlender Standardisierung noch nicht kompatibel, was die Interoperabilität erschwert. Zudem erfordern souveräne Cloud-Lösungen oft höhere Betriebsaufwände.
Trotz dieser Hindernisse ist die Stärkung der digitalen Souveränität unerlässlich, um die Verwaltung in Deutschland zukunftsfähig zu machen. Es mangelt nicht an erprobten Angeboten, sondern oft an politischem Willen und wirtschaftlicher Entschlossenheit, diese Technologien konsequent voranzutreiben. Das Ziel ist eine digitale Verwaltung, die leistungsfähig, flexibel und vertrauenswürdig ist, und in der die Bürger selbstbestimmt und sicher ausüben können, ihre Hoheit über die eigenen Daten und Systeme zu behalten.
Wege aus der Abhängigkeitsfalle: Konkrete Strategien zur Stärkung
Um digital souverän zu werden und zu bleiben, bedarf es eines koordinierten und langfristigen Engagements aller Akteure – von der Politik über die Wirtschaft bis hin zur Zivilgesellschaft. Die Forderung nach digitaler Souveränität ist eine gemeinsame Aufgabe, die nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern in den Kontext des gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses der Digitalisierung eingebettet werden muss. Es geht darum, eine Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität zu entwickeln, die sowohl präventive Maßnahmen zur Vermeidung neuer Abhängigkeiten als auch reaktive Maßnahmen zur Auflösung bestehender umfasst.
Welche Strategien zur Stärkung der digitalen Souveränität sind effektiv?
Effektive Strategien zur Stärkung der digitalen Souveränität konzentrieren sich auf mehrere Kernbereiche. Erstens ist die Diversifizierung von Technologie-Anbietern entscheidend, um Abhängigkeiten zu einzelnen Anbietern zu mindern. Dies bedeutet, Alternativen aktiv zu suchen und zu fördern, anstatt sich auf wenige große Konzerne zu verlassen. Zweitens ist die gezielte Förderung und der Einsatz von Open Source Software ein mächtiges Instrument. Durch die Unterstützung von Open Source-Ökosystemen kann der Staat zum Ankerkunden werden und von den Vorteilen transparenter und anpassbarer Software profitieren.
Drittens sind Investitionen in eigene Forschung und Entwicklung sowie die Förderung von Schlüsseltechnologien im eigenen Land essenziell. Dies schließt Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und IT-Sicherheit ein.
Viertens müssen offene Schnittstellen und Standards etabliert werden, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen zu gewährleisten und Lock-in-Effekte zu vermeiden. Schließlich ist eine kontinuierliche Stärkung der digitalen Kompetenzen auf allen Ebenen der Gesellschaft unerlässlich, um die digitale Transformation selbstbestimmt zu gestalten. Der Aufbau eines digital souveränen Staates ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Innovation und Flexibilität: Wie schaffen wir Alternativen?
Das Schaffen von Alternativen ist ein zentraler Aspekt, um mehr digitaler Souveränität zu erreichen. Dies begünstigt nicht nur die Innovation, sondern auch die Flexibilität in der IT, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Durch die Unterstützung und Entwicklung europäischer Technologien und Anwendungen kann die Abhängigkeit von digitalen Technologien aus anderen Regionen reduziert werden. Projekte wie Gaia-X sind Beispiele für den Versuch, eine souveräne digitale Infrastruktur aufzubauen. Die gezielte Förderung von Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen im digitalen Sektor trägt ebenfalls zur Diversifizierung des Anbieter-Marktes bei.
Die Nutzung von Open Source Software ist hierbei ein Treiber. Indem Open Source Anwendungen und Plattformen wie openCoDE und openDesk entwickelt und eingesetzt werden, können Bund, Länder und Kommunen ihre Gestaltungsfähigkeit erhöhen und Abhängigkeiten reduzieren. Dies ermöglicht es, digitale Technologien nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und Informationstechnik an die spezifischen Anforderungen anzupassen. Die Bereitschaft zum organisatorischen Wandel und die Etablierung strategischer Partnerschaften zwischen der öffentlichen Hand und Open Source-Communities sind dabei entscheidend für den Erfolg dieser Bemühungen.
Ausblick: Eine selbstbestimmte digitale Zukunft für Deutschland und Europa
Die Reise zu umfassender digitaler Souveränität ist ein Marathon, kein Sprint. Sie erfordert eine langfristige Vision und konsequentes Handeln von allen Beteiligten. Die digitale Welt wird sich weiterhin rasant entwickeln, und damit auch die Herausforderungen an unsere digitale Souveränität. Es ist von entscheidender Bedeutung, Abhängigkeiten zu identifizieren und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung in allen gesellschaftlichen Bereichen zu wahren.
Indem Deutschland und Frankreich, sowie ganz Europa, weiterhin auf die Stärkung der digitalen Souveränität setzen, können wir eine digitale Zukunft gestalten, die auf unseren Werten von Freiheit, Demokratie und Datenschutz beruht. Dies bedeutet, in leistungsfähige und vertrauenswürdige digitale Infrastrukturen zu investieren, den Einsatz von Open Source Software zu fördern, digitale Bildung und Kompetenzen zu stärken und eine Technologie-Politik zu verfolgen, die Innovation und Flexibilität in den Vordergrund stellt.
Nur so können wir sicherstellen, dass wir in der digitalen Welt unabhängig und selbstbestimmt bleiben und unsere Rolle in der digitalen Welt verantwortungsvoll ausfüllen. Es geht darum, nicht nur Nutzer, sondern aktive Gestalter der digitalen Transformation zu sein und die Hoheit über die eigenen digitalen Geschicke zu behalten.